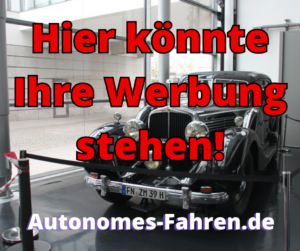Autonomes Fahren im ländlichen Raum

Wird das Autonome Fahren im ländlichen Raum überhaupt ankommen?
Die Technik des Autonomen Fahrens soll für vielerlei Dinge die Lösung darstellen. Es soll das Verkehrsvolumen senken, die Umweltbelastung reduzieren und vor allem die Verkehrssicherheit erhöhen. Gerade bei letzterem Punkt liegt das Potenzial des Autonomen Fahrens, auch wenn es jüngst eine Studie gab, die den Umfang einschränkte.

Doch es gibt noch einen weiteren Faktor, mit dem man gerne wirbt, doch der noch mehr Herausforderungen aufzeigt: die Steigerung der Mobilität. Man wirbt gerne damit, dass vor allem Ältere und Menschen mit Behinderungen von den Vorteilen des Autonomen Fahrens profitieren würden. Das mag in den Städten auch sein, aber wie steht es um die ländlichen Gebiete?
Infrastruktur und Vernetzung: Die Autonomen Fahrzeuge müssen kommunikativ sein. Derart tauschen sie Daten mit anderen Fahrzeugen, anderen Verkehrsteilnehmenden und mit der Infrastruktur aus. Ob die Übertragung mittels 5G oder über WLANp oder anderweitig gelingt, ist dabei nebensächlich. Doch der Ausbau der nötigen Infrastruktur auf dem Land ist zumindest in Deutschland traditionell schlecht. Zudem müssen nach einigen Konzepten auch RSUs (Road Side Units) angebracht werden. Darin sind Sensoren verbaut, die die Straßen und den Verkehr überwachen können. Auch diese müssen Teil der Vernetzung sein, um die Daten zu übertragen.
Kommerzialisierung und Nachfrage: Ein weiteres Hindernis für die Implementierung des Autonomen Fahrens auf dem Land ist die geringe Nachfrage. Wenn einzelne Dörfer in weitem Abstand zu einander liegen, erhöhen sich die Kosten. Denn nur wenige Leute bezahlen die Fahrt. In Städten, wo viele Kunden auf engem Raum leben, ist die Kommerzialisierung deutlich gewinnbringender.
Verkehr und Fahrbahnen: Nach Vorstellung einiger Fachleute, wird die Einführung des Autonomen Fahrens im gemischten Verkehr nur funktionieren, wenn die automatisierten Fahrzeuge eine eigene Spur erhalten. Das erscheint auf dem Land eher möglich als in der Stadt. Außerdem ist der Verkehr auf dem Land deutlich geringer, was die Implementierung fördert. Denn je mehr Verkehr, auch Fuß- und Radverkehr, desto höher der Rechenprozess durch die Sensorverarbeitung. Wobei in der Stadt eine Automatisierung des ÖPNVs eher gelingen würde als auf dem Land, wo es das oftmals gar nicht gibt.
Fazit: Vor allem das Geld gibt den Ausschlag für die Implementierung. Zwar ist auf dem Land mehr Platz für die noch vielleicht nur anfängliche Unsicherheit der Fahrzeuge, doch die Nachfrage wird das Angebot an sich ziehen. Die Kosten für die Entwicklung müssen wieder eingenommen werden, das wird eher in der Stadt möglich werden – auch wenn es auf dem Land für die Bevölkerung einen größeren Nutzen hätte.